ulfberth
(Moderator)


|
Außer dem Ehren- oder Devotionskreuz wurde vom Großmeister in Rom bis in die neuere Zeit das Ordenskreuz auch an sogen. Chevaliers de grâce (Gnadenritter) und solche adlige Personen verliehen, die sich entweder im Dienste des Ordens oder in andrer Weise hervorragende Verdienste um diesen erworben hatten, dabei aber nicht imstande waren, solche Ahnenproben zu liefern, wie dies für den eigentlichen Ehrenritter vorgeschrieben ist. Die Ernennung eines solchen Chevalier de grâce ist neuerdings zum ausschließlichen Rechte des Großmeisters erklärt worden, das er motu proprio ausübt; deshalb darf aber auch von keinem Aspiranten darum nachgesucht werden. Das Donatkreuz endlich ist seiner Bestimmung nach ein Verdienstkreuz des Ordens; es wird ausschließlich an Beamte des Ordens oder solche Personen verliehen, die sich in andrer Weise um ihn verdient gemacht haben. Für sie wird keine Ahnen- oder Adelsprobe verlangt, nur die Abstammung von ehrlichen katholischen Eltern, eine anständige Lebensstellung und unbescholtener Charakter. Souveränen und Prinzen wie überhaupt hervorragenden Personen des höchsten Adels wird zuweilen das Großkreuz des Ordens verliehen, womit die Würde des Ehrenbaillis verbunden ist.
Das Großpriorat von Böhmen hat sich die Krankenpflege und speziell den »freiwilligen Sanitätsdienst im Kriege« zur ganz besondern Aufgabe gestellt, worüber eine ausführliche Schrift unter diesem Titel (Wien 1879) erschienen ist. Das Hospiz zwischen Bethlehem und Jerusalem, dessen Protektorat der Kaiser von Österreich übernommen hat, wird durch gemeinschaftliche Beiträge des gesamten Ordens erhalten.
Die Dekoration des Großpriors, Bailli anziano, Baillis, Minister-Receveurs, der Komture und Profeßritter ist ein am schwarzen Band um den Hals getragenes goldenes, weiß emailliertes sogen. Malteserkreuz mit Krone und Trophäe, in der sich die Distinktion für Jerusalem, das Balkenkreuz im roten Felde, befindet, und außerdem auf der Brust das achtspitzige linnene Kreuz.
Johanniter- od. Malteserkreuz.
Die Rechtsritter tragen nur das goldene, weiß emaillierte Kreuz um den Hals, erst nach dem Profeß auch das Brustkreuz; sämtliche Ordensgeistliche tragen das Brustkreuz aus Leinwand. Die Chevaliers de grâce tragen das goldene Kreuz, anstatt der Trophäe eine Agraffe; die Donaten erster Klasse das goldene, weiß emaillierte Kreuz, nur ist der obere Arm nicht emailliert; die Rechtsdonaten ein Kreuzchen ohne den obern Arm; die Donaten zweiter Klasse das Kreuz mit dem Arme mit Krone, ohne Agraffe; die Ehrendamen das Kreuz der Chevaliers de grâce. Der Orden hat außerdem eine Uniform. …
Der evangelische Zweig des Johanniter-Ordens, die Ballei Brandenburg.
Durch die Kabinettsorder vom 15. Okt. 1852 und die Urkunde König Friedrich Wilhelms IV., datiert Putbus 8. Aug. 1853, wurde die Ballei Brandenburg wieder ausgerichtet, die infolge des Säkularisationsedikts vom 30. Okt. 1810, laut der Urkunde vom 23. Jan. 1811 aufgelöst worden war, deren rechtliches Bestehen auf dem Vergleich von Heimbach vom Tage St. Barnabä (11. Juni) 1382 basierte und durch den Artikel 12 im Instrument des Westfälischen Friedens ausdrücklich anerkannt worden ist. Der königlich preußische J., der 1812 gestiftet worden war, erlosch, und seine Mitglieder gingen als Ehrenritter zur neu ausgerichteten Ballei Brandenburg über, der die Förderung und Ausübung der christlichen Krankenpflege, entsprechend dem ursprünglichen Stiftungszwecke des Johanniterordens, zur Aufgabe gemacht wurde. Nachdem Prinz Karl von Preußen (gest. 21. Juni 1883) infolge der auf ihn gefallenen Wahl 17. Mai 1853 als Herrenmeister der neu ausgerichteten Ballei installiert worden war, trat das Ordenskapitel 24. Juni 1853 zum erstenmal zusammen und stellte die Statuten fest, die durch die Urkunde vom 8. Aug. 1853 landesherrlich bestätigt wurden.
Die gegenwärtige Organisation der Ballei Brandenburg, deren höchster Protektor der Kaiser und König Wilhelm II. und dessen Herrenmeister der Prinz Albrecht von Preußen ist, wurde wie folgt gestaltet: Die Ordensmitglieder stufen sich ab:
1) in Kommendatoren und Ehrenkommendatoren, die unter dem Vorsitz des Herrenmeisters nebst dem Ordenshauptmann und den Ordensbeamten das Ordenskapitel bilden;
2) Rechtsritter, die das Ordensgelübde ablegen und durch Ritterschlag und Investitur als solche aufgenommen werden;
3) Ehrenritter. Jeder Rechtsritter muß vorher Ehrenritter gewesen sein und sich wie dieser zur evangelischen Kirche bekennen.
Das Ordenskapitel entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder, bei denen adlige Geburt, ein Lebensalter von 30 Jahren und eine der Würde des Ordens entsprechende soziale Stellung Bedingung ist. Jeder Ehrenritter zahlt an die Ordenskasse ein Eintrittsgeld von 1000 Mark. und einen jährlichen Beitrag von 60–90 Mark., je nachdem er einer der 15 Genossenschaften des Ordens in den preußischen Provinzen und in Württemberg, Mecklenburg, Hessen, Sachsen und Bayern beigetreten ist.
Die Ballei zählte 1. Jan. 1905: einen Herrenmeister, 18 Kommendatoren, 4 Ehrenkommendatoren, einen Ordenshauptmann, 973 Rechtsritter, 2 Ehrenmitglieder und 1912 Ehrenritter, zusammen 2911 Mitglieder. Die Ballei und ihre Genossenschaften besitzen zurzeit 50 Kranken- und Siechenhäuser mit 2860 Betten, in denen 1904 zusammen 18,000 Kranke u. Sieche, zusammen 751,328 Tage ärztlich behandelt und zum Teil unentgeltlich oder für einen die Selbstkosten nicht deckenden mäßigen Betrag verpflegt worden sind, außerdem in Jerusalem an der Via dolorosa ein Hospiz zur Aufnahme von Reisenden. Bei Landeskalamitäten sowie während der Kriege 1864, 1866 und 1870/71 hat der Orden Gelegenheit gefunden, sich segensreich zu betätigen.
Ordenskleidung der Rechtsritter des Johanniterordens.
Das Ordenszeichen, ein goldenes achtspitziges, weiß emailliertes Kreuz mit goldenen Adlern zwischen den Armen und einer Krone bei den Rechtsrittern, mit schwarzen Adlern und ohne Krone bei den Ehrenrittern, wird an einem schwarzen Band um den Hals, außerdem das einfache weiße linnene Kreuz auf der linken Brust getragen. Die Ordenskleidung besteht seit 1896 für die Rechtsritter in einem scharlachroten, oben aufgeschlagenen. mit zwei Reihen von Johanniterknöpfen besetzten Waffenrock, dessen Kragen, Ärmelaufschläge, Rabatten- und Taschenbesatz weiß mit goldener Stickerei sind, weißen Beinkleidern, hohen Stiefeln mit weiten Stulpen und goldenen Anschnallsporen und schwarzem Filzhut mit goldener Schnur, weißer und schwarzer Straußfeder und statt der Agraffe mit einer schwarzseidenen Schleife mit weißem Johanniterkreuz. Das Schwert mit brauner Lederscheide wird an einem goldenen Schwertgurt mit einem mit silbernem Johanniterkreuz belegten Schloß getragen. Auf den Schultern befindet sich ein goldenes Geflecht mit Johanniterkreuz. Das Ordenskreuz wird an dem schwarzen Band über dem Rock getragen. Die Uniform der Ehrenritter unterscheidet sich von der der Rechtsritter dadurch, daß die Rabatten rot, die Sporen stählern sind und sich auf dem Hute zwei schwarze Straußenfedern befinden. Die Kommendatoren, Ehrenkommendatoren und der Ordenshauptmann tragen auf den Schultern goldene Raupen. Zur kleinen Uniform werden lange schwarze Beinkleider mit goldenen Tressen getragen. Für den Dienst in der freiwilligen Krankenpflege im Kriege besteht eine Interimsuniform.
1886 hat der Orden auch begonnen, deutsche evangelische Jungfrauen und Witwen auf seine Kosten durch Diakonissenhäuser, mit denen der Orden ein Abkommen darüber getroffen hat, in der Krankenpflege ausbilden zu lassen. Nachdem diese Lehrpflegerinnen für den Dienst des Ordens geeignet befunden worden sind, erhalten sie ein vom Herrenmeister ausgefertigtes Patent, durch das sie als »dienende Schwestern des Ordens« aufgenommen werden. Bis 1903 sind 1620 dienende Schwestern ernannt worden. 1904 verfügte der Orden über 985 dienende Schwestern, von denen 858 als felddienstmäßig bezeichnet werden konnten. …
Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 10. Leipzig 1907
www.seitengewehr.de
|
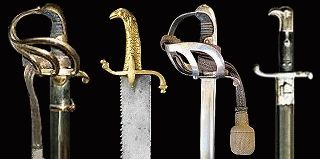
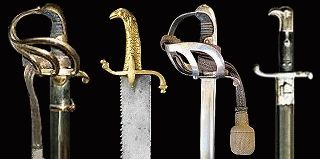
 19.02.08, 17:52:14
19.02.08, 17:52:14
 22.02.10, 22:58:01
22.02.10, 22:58:01
 23.02.10, 00:17:42
23.02.10, 00:17:42
 23.02.10, 00:18:55
23.02.10, 00:18:55
 23.02.10, 00:20:03
23.02.10, 00:20:03
 23.02.10, 00:21:36
23.02.10, 00:21:36
 23.02.10, 00:22:01
23.02.10, 00:22:01
 23.02.10, 00:39:02
23.02.10, 00:39:02
 25.02.10, 08:11:49
25.02.10, 08:11:49
 12.09.10, 22:50:27
12.09.10, 22:50:27